Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt gehören zu den grössten Umbrüchen unserer Zeit. Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, welche Berufe bestehen bleiben und welche verschwinden könnten. Automatisierung bringt Chancen wie höhere Produktivität und neue Arbeitsfelder, birgt aber auch Risiken wie Arbeitsplatzverluste oder steigende Ungleichheit. Dieser Artikel gibt einen umfassenden Überblick über Zahlen, Prognosen und Studien, beleuchtet Chancen und Herausforderungen und zeigt, wie Unternehmen, Politik und Gesellschaft den Wandel aktiv und nachhaltig gestalten können.
Daniele Bardaro, Job-Coach & Outplacment Spezialist
4 Minuten Lesezeit
Wie KI den Arbeitsmarkt verändert
Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sind aktuell eine der meistdiskutierten Entwicklungen unserer Zeit. Besonders die Automatisierung von Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz (KI) sorgt für intensive Debatten. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT Anfang dieses Jahres hat das Thema neuen Auftrieb erhalten und ist in der breiten Öffentlichkeit angekommen, wie künstliche Intelligenz genutzt werden kann.
Während einige die Technologie als Motor für Innovation und Wirtschaftswachstum sehen, befürchten andere massive Arbeitsplatzverluste. Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt und die globalen Beschäftigungssysteme sind jedoch umstritten – je nach Studie und Perspektive gehen die Prognosen deutlich auseinander.
In diesem Artikel beleuchten wir aktuelle Zahlen, Fakten und Prognosen, betrachten Chancen und Risiken und zeigen auf, welche Berufsgruppen im Wandel sind und besonders betroffen sein könnten.
Zahlen und Fakten zu den Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt
Wichtige Studien und Prognosen
Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (2018) könnten die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt dazu führen, dass bis 2025 weltweit rund 75 Millionen Arbeitsplätze durch KI und Automatisierung ersetzt werden – das entspricht etwa 3 % aller Jobs. Das McKinsey Global Institute (2017) stellte fest, dass etwa die Hälfte aller Arbeitsaktivitäten theoretisch automatisierbar ist – umgerechnet wären das 1,2 Milliarden Arbeitsplätze weltweit.
Faktoren, die den Einfluss von KI bestimmen
- Regionale Unterschiede
- Lohnniveau
- Technologische Reife
- Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte
Welche Branchen und Berufe am stärksten betroffen sind
Branchen mit hohem Automatisierungspotenzial
Studien zeigen, dass Fertigungsindustrie, Transport, Logistik und Einzelhandel das höchste Automatisierungspotenzial aufweisen. In der Fertigung könnten bis zu 45 % der Jobs ersetzt werden, in Transport/Logistik und im Detailhandel rund 40 %. Weniger betroffen sind Bereiche, die hohe zwischenmenschliche Interaktion und kreative Problemlösung erfordern – wie Bildung, Gesundheitswesen und Sozialarbeit.
Berufe mit geringer Auswirkung von KI
Diese Tätigkeiten haben ein niedriges Automatisierungspotenzial, da sie stark auf zwischenmenschliche Interaktion, Kreativität oder physisch komplexe Aufgaben angewiesen sind, die Maschinen bislang nicht in vergleichbarer Qualität leisten können.
- Sozialarbeitende – unterstützen Menschen in schwierigen Lebenssituationen, beraten individuell und arbeiten oft mit sensiblen persönlichen Themen.
- Zahnärztinnen / Zahnärzte – erfordern präzise manuelle Fertigkeiten und direkte Patient:innenbetreuung.
- Therapeutinnen / Therapeuten – setzen auf persönliche Interaktion und individuell angepasste Behandlungspläne.
- Personalmanagerinnen / Personalmanager – sind in Personalentwicklung, Rekrutierung und Konfliktmanagement tätig, wo Empathie und strategisches Denken gefragt sind.
- Lehrpersonen – gestalten Lernprozesse, fördern individuelle Entwicklung und bauen eine Beziehung zu ihren Schüler:innen auf.
- Pflegefachkräfte – übernehmen körpernahe Betreuung, medizinische Pflege und emotionale Unterstützung.
- Künstlerinnen / Künstler – schaffen originelle Werke und kreative Konzepte, die von menschlicher Inspiration leben.
- Geistliche / Seelsorgerinnen – begleiten Menschen in spirituellen und persönlichen Lebensfragen und erfüllen oft rituelle Aufgaben.
Berufe mit mittlerem Risiko
Diese Berufe sind teilweise automatisierbar. Viele Aufgaben lassen sich durch KI unterstützen oder effizienter gestalten, aber der Beruf als Ganzes bleibt erhalten – oft mit veränderter Rolle und neuen Anforderungsschwerpunkten.
- Editorinnen / Editoren – nutzen KI-Tools für Rechtschreibung, Grammatik und Formatierungen, während kreative und inhaltliche Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden.
- Softwareentwicklerinnen / Softwareentwickler – profitieren von KI bei Code-Generierung, Debugging und Tests, übernehmen jedoch weiterhin komplexe Architekturplanung und kreative Problemlösungen.
- Marketing-Spezialistinnen / Spezialisten – setzen KI für Datenanalysen und Kampagnenoptimierungen ein, behalten jedoch die kreative Konzeptentwicklung in der Hand.
- Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte – lassen sich bei Recherchen und Dokumentenerstellung unterstützen, treffen jedoch strategische und taktische Entscheidungen selbst.
Berufe mit hoher Auswirkung von KI
Diese Tätigkeiten weisen ein hohes Automatisierungspotenzial auf, da sie stark regelbasiert, datengetrieben oder repetitiv sind. Hier können KI-Systeme viele Aufgaben vollständig übernehmen.
- Buchhalterinnen / Buchhalter – Routinebuchungen, Steuerberechnungen und Standardberichte lassen sich fast vollständig automatisieren.
- Finanzanalystinnen / Finanzanalysten – nutzen KI für Marktanalysen und Prognosen, wodurch menschliche Analyseanteile sinken.
- Versicherungsunderwriterinnen – Risikobewertungen und Policenprüfungen können automatisiert erfolgen.
- Datenerfasserinnen – reine Dateneingabe und -pflege ist zu 100 % automatisierbar.
- Bankangestellte (Schaltertätigkeiten) – viele Services werden durch Self-Service-Terminals oder digitale Assistenten ersetzt.
- Prüfungs- und Buchhaltungsassistenzen – Standardprüfungen lassen sich vollständig automatisieren.
- Ökonominnen / Ökonomen – statistische Auswertungen können KI-gestützt erfolgen, menschliche Interpretation bleibt eingeschränkt nötig.
- Detailhandelsverkäuferinnen / Verkäufer – Self-Checkout und Onlinehandel reduzieren den Personalbedarf.
- Kundendienstmitarbeitende – Standardanfragen werden zunehmend durch Chatbots und Sprach-KI übernommen.
- Marktanalystinnen / Marktanalysten – Datensammlung und -auswertung kann KI schneller und in grösserem Umfang leisten.
Unterschiedliche Studien – warum die Prognosen variieren
Nicht alle Forschungsarbeiten malen ein düsteres Bild. Das Oxford Martin Programme on Technology and Employment (2017) schätzt, dass nur 9 % der Arbeitsplätze weltweit direkt durch KI ersetzt werden könnten. McKinsey prognostiziert für die USA bis 2030 sogar nur 5 %.
Gründe für die Abweichungen:
- Unterschiedliche methodische Ansätze – Einige Studien berechnen ausschliesslich, welche Tätigkeiten technisch automatisierbar sind, während andere zusätzlich Faktoren wie wirtschaftliche Umsetzbarkeit, regulatorische Hürden oder gesellschaftliche Akzeptanz einbeziehen.
- Technologischer Entwicklungsstand – In Ländern mit hohem Digitalisierungsgrad und besserer Infrastruktur kann KI schneller implementiert werden, was zu höheren Automatisierungsraten führt.
- Regionale Wirtschaftslage – In wirtschaftlich starken Regionen mit hohem Lohnniveau lohnt sich Automatisierung oft eher als in Ländern mit niedrigeren Arbeitskosten.
- Politische Rahmenbedingungen – Regulierungen, Datenschutzgesetze oder staatliche Förderprogramme beeinflussen, wie schnell und in welchem Umfang KI-Lösungen am Arbeitsmarkt eingeführt werden.
Zudem ersetzt KI nicht nur Arbeit – sie schafft auch neue Jobs, z. B. in KI-Entwicklung, Datenanalyse und menschlicher Überwachung von KI-Systemen.
Chancen und Risiken der Automatisierung durch KI
Positive Effekte für Wirtschaft und Unternehmen
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann Unternehmen auf vielfältige Weise voranbringen:
- Höhere Produktivität – KI kann Routineaufgaben schneller und fehlerfrei erledigen, wodurch Mitarbeitende mehr Zeit für strategische und kreative Tätigkeiten haben.
- Kostensenkung – Durch Automatisierung lassen sich Personalkosten, Fehlerquoten und Produktionsausfälle deutlich reduzieren.
- Schnellere Prozesse – Datenanalysen, Entscheidungsfindung und Kundenanfragen können in Echtzeit bearbeitet werden, was die Reaktionsgeschwindigkeit steigert.
- Effizientere Ressourcennutzung – KI optimiert den Einsatz von Material, Energie und Zeit, wodurch Betriebskosten sinken und Nachhaltigkeit gefördert wird.
- Neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle – KI eröffnet neue Märkte, ermöglicht personalisierte Angebote und unterstützt die Entwicklung innovativer Produkte.
Herausforderungen und soziale Risiken
Trotz der Chancen bringt der zunehmende Einsatz von KI auch erhebliche Herausforderungen mit sich:
- Arbeitsplatzverluste bei Geringqualifizierten – Tätigkeiten, die leicht automatisierbar sind, fallen weg, was besonders Menschen mit niedriger Qualifikation betrifft.
- Einkommenspolarisierung – Gut ausgebildete Fachkräfte profitieren oft von den neuen Möglichkeiten, während andere Gruppen vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.
- Steigender Weiterbildungsdruck – Berufsbilder verändern sich schnell, wodurch lebenslanges Lernen zur Notwendigkeit wird.
- Gefahr sozialer Ungleichheit – Wenn Bildungssysteme und Umschulungsangebote nicht Schritt halten, können ganze Bevölkerungsgruppen den Anschluss verlieren, was die soziale Spaltung verstärkt.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Dynamiken
Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt reichen weit über die reine Frage nach dem Erhalt oder Verlust einzelner Arbeitsplätze hinaus. Künstliche Intelligenz verändert grundlegende Strukturen der Wertschöpfungsketten, schafft neue Möglichkeiten im Kundenzugang und führt zu einer stärkeren Vernetzung ganzer Branchen. Unternehmen können durch KI globale Märkte schneller erschliessen und Geschäftsmodelle radikal umgestalten – was wiederum den Druck auf Wettbewerber erhöht, ebenfalls zu digitalisieren.
Gleichzeitig zeigen die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt auch regionale und internationale Ungleichgewichte: Länder mit fortschrittlicher digitaler Infrastruktur und hoher Investitionsbereitschaft können KI schneller und effektiver nutzen, während andere Gefahr laufen, wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten.
Hinzu kommt eine ethische Dimension, die im Kontext der Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt nicht unterschätzt werden darf. Themen wie Datenschutz, algorithmische Fairness, Transparenz und die Vermeidung von Diskriminierung sind entscheidend, um das Vertrauen von Konsumentinnen, Mitarbeitenden und Gesellschaft in KI-Systeme zu sichern. Fehlender ethischer Rahmen könnte nicht nur zu sozialen Spannungen, sondern auch zu wirtschaftlichen Nachteilen führen.
Strategien, um die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt positiv zu gestalten
- Investitionen in Bildung und Umschulung – Qualifikationen müssen laufend an den technologischen Wandel angepasst werden. Dazu gehören moderne Lehrpläne, praxisorientierte Weiterbildung und flexible Umschulungsprogramme, um Arbeitskräfte fit für neue Berufsfelder zu machen.
- Förderung neuer Branchen wie Green Tech und Digital Health – Zukunftssektoren schaffen neue Arbeitsplätze und bieten Wachstumschancen, die den Abbau in anderen Bereichen abfedern können.
- Ethische Leitlinien und Regulierung – Klare Regeln für den Einsatz von KI verhindern Missbrauch, schützen Datenschutz und sorgen für Fairness im Wettbewerb.
- Soziale Absicherung für Betroffene – Arbeitslosengeld, Umschulungshilfen und Übergangsprogramme helfen, den sozialen Druck abzufedern, wenn Arbeitsplätze wegfallen.
- Förderung menschlicher Kernkompetenzen – Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikationsstärke und kritisches Denken bleiben auch im KI-Zeitalter unersetzlich und sollten gezielt gefördert werden.
Was Arbeitnehmende tun können, wenn sie von KI betroffen sind
Wer feststellt, dass der eigene Beruf ein hohes Automatisierungspotenzial hat, sollte frühzeitig aktiv werden. Ein erster Schritt ist die Analyse der eigenen Kompetenzen: Welche Fähigkeiten sind schwer automatisierbar und können ausgebaut werden? Dazu gehören vor allem soziale Kompetenzen, kreative Problemlösung und bereichsübergreifendes Denken. Weiterbildung und Umschulung spielen eine zentrale Rolle – etwa durch den Erwerb digitaler Kompetenzen, den Einstieg in zukunftsträchtige Branchen oder den Ausbau von Projekt- und Führungskompetenzen. Auch Netzwerken ist wichtig, um frühzeitig von neuen Jobchancen zu erfahren. Zudem kann es sinnvoll sein, die eigene Rolle im Unternehmen neu zu positionieren, etwa indem man sich in Innovationsprojekten engagiert oder KI-gestützte Tools aktiv in die Arbeit integriert, um den eigenen Wert für den Arbeitgeber zu steigern.
Was Unternehmen tun können, wenn Mitarbeitende vom KI-Wandel betroffen sind
Unternehmen, die erkennen, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bestehende Rollen verändert oder überflüssig macht, tragen eine wichtige Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden. Ein zentraler Ansatz ist die frühzeitige und transparente Kommunikation über geplante Veränderungen, damit Unsicherheiten reduziert werden und Betroffene ausreichend Zeit haben, sich vorzubereiten. Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme sollten aktiv angeboten und finanziell unterstützt werden, um bestehende Teams für neue Aufgabenfelder zu qualifizieren. Dabei lohnt es sich, gezielt Kompetenzen zu fördern, die KI nicht ersetzen kann – wie Kreativität, strategisches Denken und zwischenmenschliche Zusammenarbeit. Auch interne Jobwechsel oder Rotationsprogramme können helfen, wertvolles Wissen im Unternehmen zu halten. Unternehmen, die diesen Weg gehen, sichern nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern stärken auch Loyalität und Motivation innerhalb der Belegschaft.
Fazit: KI als Werkzeug für eine nachhaltige Arbeitswelt
Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sind weder ausschliesslich Bedrohung noch reiner Segen – sie stellen einen tiefgreifenden Wandel mit komplexen Folgen dar. Während in manchen Bereichen Arbeitsplätze verschwinden, entstehen in anderen neue Möglichkeiten. Entscheidend wird sein, ob Regierungen, Unternehmen und Gesellschaft den Wandel aktiv gestalten – mit klugen Bildungsstrategien, sozialer Verantwortung und innovationsfreundlicher Politik. Gelingt dies, kann KI zu einem Werkzeug werden, das den Menschen entlastet und neue Perspektiven eröffnet, statt ihn zu verdrängen.

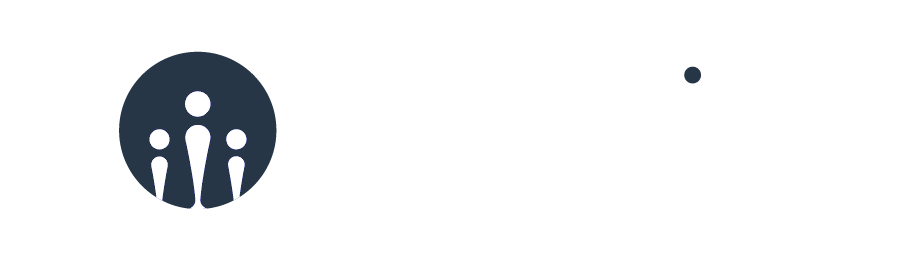

Wir sind für Sie da
Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen
Kontaktieren Sie uns jederzeit – wir nehmen uns gerne Zeit für Ihr Anliegen und freuen uns auf Ihre Nachricht.